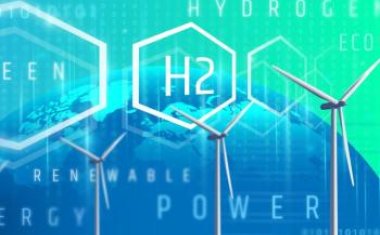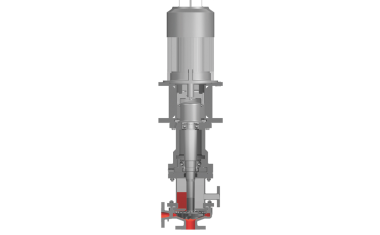Wie kryogene Verfahren Automatisierung in der Lebensmittelindustrie ermöglichen
In modernen Lebensmittelproduktionen ist Automatisierung längst ein Muss – sie ist entscheidend für Effizienz, Hygiene und Skalierbarkeit. Doch viele Prozesse scheitern an den physikalischen Eigenschaften der Produkte: zu weich, zu klebrig, zu instabil. Die Lösung? Kältetechnik, die weit über bloße Konservierung hinausgeht. Ansgar Rinklake, Market Manager Food & Pharma bei Air Liquide, erklärt, wie gezielte Kälteimpulse Produktionsprobleme lösen – und so die Automatisierung ganzer Prozessschritte erst möglich machen.
Kälte als Taktgeber – Interview mit Ansgar Rinklake, Air Liquide

Herr Rinklake, die Bedeutung von Kälte in der Lebensmittelindustrie ist unbestritten – doch Air Liquide spricht davon, dass Kälte heute nicht mehr nur konserviert, sondern Prozesse gestaltet. Was genau ist damit gemeint?
Rinklake: Das ist tatsächlich ein neuer Ansatz. Kälte wurde früher als klassisches End-of-Line-Instrument betrachtet: ein Hilfsmittel zur Haltbarmachung oder Lagerung. Heute verstehen wir Kälte als einen aktiven Eingriff in den Produktionsprozess – als Werkzeug, das Prozesssicherheit schafft und Automatisierung überhaupt erst möglich macht. Sie kann beispielsweise dazu beitragen, instabile oder schwer handhabbare Produkte temporär zu stabilisieren. Wir sprechen also nicht mehr nur von Kühlung im Sinne von Temperaturabsenkung, sondern von gezieltem Prozesskühlen – dort, wo es produktionsrelevant ist.
Können Sie das an einem praktischen Beispiel veranschaulichen?
Rinklake: Sehr gern. Denken Sie an marinierte Hackfleischprodukte – zum Beispiel Burgerpatties. Diese kommen oft noch warm aus dem Ofen, sind klebrig und haben eine unregelmäßige Oberfläche. Für automatisierte Verpackungslösungen sind das denkbar schlechte Voraussetzungen: Vakuumgreifer oder mechanische Systeme kommen hier schnell an ihre Grenzen. Früher hat man in solchen Fällen oft auf manuelle Verpackung zurückgegriffen – mit entsprechendem Personalaufwand. Heute setzen wir auf punktuelle Oberflächenkühlung mit flüssigem Stickstoff. Die Oberfläche wird kurzzeitig verfestigt, das Produkt lässt sich zuverlässig greifen und verpacken. Das reduziert nicht nur den Ausschuss, sondern verdoppelt im besten Fall sogar die Linienleistung – bei gleichbleibender Produktqualität.
Mit Kältetechnik manueller Bearbeitung vermeiden

Sie sprechen von punktuellen Eingriffen. Wie früh sollte Kältetechnologie Ihrer Meinung nach in die Planung eines Produktionsprozesses einbezogen werden?
Rinklake: So früh wie möglich – idealerweise schon in der Entwicklungsphase neuer Produkte oder beim Re-Design von Prozesslinien. Denn viele Herausforderungen, die später als „Störfaktoren“ auftauchen, lassen sich durch Kälte frühzeitig entschärfen. Das betrifft beispielsweise Produkte mit instabiler Konsistenz oder hohen Verarbeitungstemperaturen, empfindliche Toppings oder klebrige Oberflächen. All das beeinflusst, ob und wie ein Produkt automatisiert verarbeitet werden kann. Wer Kälte erst am Ende denkt, verpasst oft die Chance, Prozesse schlanker und robuster zu gestalten.
Welche Produkte eignen sich besonders für eine solche Kälteintegration – und gibt es auch Anwendungen, bei denen Sie die Branche noch zu zögerlich erleben?
Rinklake: Die große Chance liegt gerade bei empfindlichen oder klebrigen Produkten, die bisher aus Qualitätsgründen manuell gehandhabt werden – etwa vorgegarte Komponenten mit Sauce oder Marinade, fertig belegte Snacks oder filigrane Rohwaren. Hier sehen wir in vielen Betrieben noch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Kältetechnologie – meist aus Sorge vor Geschmacks- oder Strukturveränderungen. Doch diese Sorge ist unbegründet, wenn man mit der richtigen Technologie arbeitet. Wir setzen gezielte, sehr kurzfristige Kälteimpulse ein, welche die Oberfläche stabilisieren, ohne in das Innere des Produkts einzudringen. Das Ergebnis ist eine temporäre Festigkeit, die Automatisierung erlaubt, ohne dass die sensorischen Eigenschaften des Produkts leiden.
Gibt es spezielle Systeme oder Verfahren, mit denen Sie diese Effekte erzielen?
Rinklake: Ja, unser Portfolio umfasst verschiedene modulare Systeme, die jeweils auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind. Besonders häufig setzen wir den einen Tunnelfroster ein – der mit einem speziellen Kunststoffband ausgestattet ist. Dieses Transportband ist getränkt mit flüssigen Stickstoff. Damit erreicht man eine sehr schnelle Stabilisierung der Produktunterseite, falls notwendig wird das Produkt ebenfalls von oben mit flüssigen Stickstoff besprüht.
Für lose, empfindliche Produkte wie Mozzarellakugeln, Filetstreifen oder pflanzenbasierte Produkte verwenden wir das sogenannte IQF-Frosten. Dabei werden die Produkte in einer rotierenden Trommel kontinuierlich bewegt, während sie mit einem gezielten Kältestrom behandelt werden. Das verhindert ein Verkleben oder Verklumpen – ein Riesenvorteil beim exakten Dosieren und Verpacken. All unsere Systeme arbeiten nach dem Baukastenprinzip und lassen sich an Produkt und Linie individuell anpassen.

Wie läuft ein typisches Projekt ab, wenn ein Kunde seine Linie umstellen oder automatisieren will?
Rinklake: Meist startet es mit einem konkreten Problem: „Wir kommen mit diesem Produkt an unsere Grenzen“ – sei es in der Verpackung, beim Schneiden oder in der Handhabung. Dann analysieren wir gemeinsam mit dem Kunden den Prozess: Wo liegt der Engpass? Welche Temperaturen herrschen in den kritischen Phasen? Wie ist die Produktkonsistenz beschaffen? Auf Basis dieser Daten entwickeln wir eine passgenaue Lösung – entweder durch die Integration von Standardmodulen oder durch eine individuell zugeschnittene Anpassung. Der Vorteil unserer Systeme liegt darin, dass sie sich mit minimalem Umrüstaufwand integrieren lassen – oft ohne tiefgreifende Eingriffe in die bestehende Prozessstruktur.
Automatisierung braucht Geschwindigkeit. Welche Produktionsprobleme lassen sich mit Kälte besonders schnell lösen?
Rinklake: Vor allem jene, die mit thermisch bedingter Instabilität zu tun haben. Ein klassisches Beispiel ist das Formen von Teig- oder Fleischprodukten: Ist das Ausgangsmaterial zu warm, verliert es Formstabilität – der Ausstoß sinkt, der Ausschuss steigt. Auch in der Schneidtechnik beobachten wir das: Weiche, warme Produkte lassen sich nicht präzise portionieren. Hier kann ein gezielter Kälteimpuls für sofortige Prozessstabilität sorgen. Und das, ohne an der Rezeptur oder an der Linie etwas ändern zu müssen. So lassen sich Durchsatzprobleme in kürzester Zeit beheben – ein echter Quick Win in der Produktion.
Kälte als Problemlöser
Ein weiteres zentrales Thema in der Industrie ist die Energieeffizienz. Wie schlagen sich kryogene Systeme im Vergleich zu konventionellen Kühlverfahren?
Rinklake: Das ist eine häufige Frage – und eine berechtigte. Kryogene Kälte arbeitet mit extrem kurzen Kontaktzeiten und kühlt ausschließlich dort, wo es notwendig ist. Das unterscheidet sie grundlegend von mechanischer Kühlung, bei der oft ganze Räume oder komplexe Maschinenteile dauerhaft gekühlt werden müssen. Das bedeutet: Unsere Systeme sind nicht nur präziser, sondern oft auch deutlich energieeffizienter. Natürlich hängt die Gesamtbilanz vom Einzelfall ab – wir beraten deshalb individuell und betrachten auch immer die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Hinzu kommt: Mechanische Kälte stößt bei gewissen Anforderungen schnell an Grenzen – etwa bei sehr schnellen Temperaturwechseln oder bei extrem empfindlichen Produkten.
Kälte als Problemlöser klingt vielversprechend – doch sehen Sie auch Grenzen dieser Technologie?
Rinklake: Kälte kann viel, aber nicht alles. Sie ist kein Ersatz für eine gute Linienführung oder eine durchdachte Produktentwicklung. Aber sie kann dort entscheidend eingreifen, wo klassische Verfahren versagen – ohne dabei invasive Änderungen im Prozess zu erfordern. Die wichtigste Voraussetzung ist: Man muss bereit sein, Kälte nicht nur als „Kühlung“ zu sehen, sondern als aktiven Bestandteil der Automatisierung. Wer diesen Schritt geht, gewinnt an Flexibilität, Prozesssicherheit und Geschwindigkeit.
Abschließend gefragt: Was ist aus Ihrer Sicht der größte Irrtum über Kältetechnologie in der Lebensmittelindustrie?
Rinklake: Der größte Irrtum ist, dass Kälte gleich Kühlraum ist. Viele stellen sich bei Kältetechnik große, energiehungrige Anlagen vor, die am Ende der Linie arbeiten. Das entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Kryogene Kälte ist präzise einsetzbar und einfach zu integrieren. Sie kann nicht nur kühlen,: sie kann Prozesse ermöglichen, die ohne sie gar nicht möglich wären. Wer das erkennt, öffnet die Tür zu echter Produktionsinnovation.