Bioburden-Kontrolle Pharma: Neue USP Standards und Annex 1 Anforderungen
Die Pharmaindustrie steht vor neuen Herausforderungen: Bioburden-Monitoring wird zur Pflicht, alternative Testmethoden ersetzen Tierversuche, und die USP überarbeitet Standards für Desinfektion. Annex 1 fordert chargenweise Bioburden-Tests vor Sterilisation. Aseptikon 2024 beleuchtet diese Entwicklungen.
Autor: Axel H. Schroeder, Fachbereichsleiter, Concept Heidelberg

In den vergangenen Jahren scheint sich in verschiedenen Bereichen die regulatorische Entwicklung beschleunigt zu haben. Vielleicht ist das nach den regulatorisch eher entwicklungsarmen Jahren der Pandemie ein subjektiver Eindruck; eventuell stoßen aber auch einzelne Entwicklungen einfach nachfolgende Aktivitäten an. So hat der 3R-Ansatz zur Vermeidung von Tierversuchen, den nach den europäischen Behörden inzwischen auch die US-FDA, das NIH und vor kurzem auch die WHO aufgegriffen haben, eindeutig dazu geführt, dass im Bereich der pharmazeutischen Qualitätskontrolle bisherige Testmethoden wie der Pyrogentest am Kaninchen bzw. der LAL-Test zunehmend durch alternative Testsysteme wie MAT und rFC ersetzt werden. Im Bereich der Bioassays und Potency Assays wird nun verstärkt auf In-Vitro Methoden wie etwa zellbasierte Assays gesetzt.
Auch der Annex 1 hat zu weiteren Aktivitäten geführt: zum einen bspw. mit seinen Forderungen zu Risk Assessment oder Kontaminationskontrollstrategien, zum anderen aber auch mit seinen Aussagen zu Reinigung und Desinfektion mit Bezug auf Rückstände und Wirksamkeiten. Der Annex 1 als global beachtetes Dokument spiegelt sich auch in entsprechenden Guidelines zur aseptischen Herstellung anderer Organisationen wie PIC/S oder WHO wieder. Ob Überarbeitungen wie die des USP Kapitels <1072> zum Thema Desinfektion daraus abgeleitet werden können, ist wohl Ansichtssache. Da der Annex 1 jedoch so etwas wie den „Stand von Wissenschaft und Technik“ darstellt, führt er automatisch zur Neubewertung anderer Vorgaben und Leitfäden.
Bioburden – mikrobielle Belastung eines Produkts oder Materials
Im Bereich der mikrobiologischen Risikobewertung und Qualitätskontrolle ist das Thema Bioburden seit einiger Zeit stärker in den Fokus gerückt. Der Begriff Bioburden bezeichnet die mikrobielle Belastung eines Produkts oder Materials, z. B. vor einer Sterilisation. In der pharmazeutischen Qualitätskontrolle dient die Bioburden-Bestimmung dazu, die Anzahl und Art von Mikroorganismen auf Rohstoffen, Zwischenprodukten und Endprodukten zu quantifizieren. Dies ist essenziell, um die Wirksamkeit der Sterilisation oder anderer Dekontaminationsmaßnahmen zu bewerten, zu validieren und Kontaminationsrisiken zu minimieren.
Im Rahmen der Qualitätssicherung stellt das Bioburden-Monitoring sicher, dass Herstellungsprozesse unter kontrollierten hygienischen Bedingungen ablaufen. Es unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben wie GMP (Good Manufacturing Practice) und hilft, Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Eine konsistente Bioburden-Kontrolle ist daher ein wichtiger Bestandteil zur Sicherstellung der Produktqualität und Patientensicherheit.
Regulatorischer Hintergrund

Auch von regulatorischer Seite wurde das Thema deshalb schon vor Jahren aufgegriffen. Im Pharmacopeial Forum 39(4) veröffentlichte die United States Pharmacopeia (USP) im Jahr 2014 den Entwurf des Kapitels <1115> mit dem Titel „Bioburden Control of Nonsterile Drug Substances and Products“. Dieses Dokument präsentierte einen risikobasierten Ansatz zur Kontrolle potenzieller mikrobieller Kontaminationen während der Herstellung nicht-steriler Arzneimittel. Doch das Thema Bioburden-Belastung betrifft keineswegs nur nicht-sterile Produkte. Der aktuelle Anhang 1 des Europäischen GMP-Leitfadens hebt ausdrücklich hervor, dass geeignete Vorfilter zur Reduzierung der mikrobiellen Belastung sowie Sterilisationsfilter an verschiedenen Punkten des Herstellungsprozesses eingesetzt werden können. Darüber hinaus fordert der Leitfaden eine Überwachung der Bioburden vor der Sterilisation. Für diesen Schritt müssen arbeitsplatzspezifische Grenzwerte definiert sein, die sich auf die Effizienz des angewandten Sterilisationsverfahrens beziehen. Außerdem schreibt der Leitfaden vor, dass der Bioburden-Test für jede Charge verpflichtend durchzuführen ist – unabhängig davon, ob es sich um aseptisch abgefüllte Produkte oder um endsterilisierte Produkte handelt. Auch auf internationaler Ebene existieren Vorgaben: Die Bioburden-Prüfung für Medizinprodukte ist weltweit durch die ISO 11737 geregelt.
Diese aktuellen Entwicklungen haben uns dazu veranlasst, das Thema Bioburden-Kontrolle im Gespräch mit Expertinnen und Experten, z.B. aus der Pharmaceutical Microbiology Working Group der ECA, noch einmal zu beleuchten und unterschiedliche Perspektiven auf dieses wichtige Qualitätskriterium zu diskutieren. Die Diskussionen mit den Expertinnen und Experten aus den Bereichen Pharmakopöe, pharmazeutische Qualitätskontrolle sowie aus Prüflaboren zeigen dabei auf, welche Herausforderungen mit der Etablierung einer Bioburden-Kontrollstrategie verbunden und welche Fragestellungen bei einer Implementierung zu erwarten sind.
Die Herausforderung: Bioburden-Kontrollstrategie
Ein zentrales Thema war die Entwicklung von Bioburden-Kontrollstrategien, die sich an den verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus orientieren. Dazu gehören die frühe klinische Phase, die späte klinische Phase sowie die kommerzielle Phase. In der näheren Vergangenheit wurden deshalb verschiedene Aspekte und Fragestellungen unter den betroffenen Anwendern diskutiert. Zum Beispiel die Frage, ob der Fokus beim Testen auf „spezifizierte Mikroorganismen“ oder auf „unerwünschte Mikroorganismen“ gelegt werden sollte. Dies betrifft alle relevanten Stufen von der Prüfung der Rohmaterialien über In-Prozesskontrollen, die Arzneimittelsubstanz und das Arzneimittelprodukt bis hin zum Endprodukt.
Ein weiterer Diskussionspunkt war das Thema Biofilme, deren Biologie und Methoden zur Identifikation von Biofilmen in der Bioburden-Entwicklung.
Ein wichtiges Thema ist außerdem die Frage, an welchen Stellen im Prozess Bioburden-Tests sinnvoll durchgeführt werden sollten. Dazu gehört auch die Vordefinition von Bioburden- oder Endotoxingehalt in Rohmaterialien sowie die Bewertung, ob „unerwünschte Mikroorganismen“ in den eingesetzten Rohstoffen vorhanden sind. Hinsichtlich der Methodik kommen verschiedene Testverfahren zur Anwendung, darunter der Total Aerobic Microbial Count (TAMC), der Total Yeast and Mold Count (TYMC), die Methode der Most Probable Number (MPN), weitere klassische Bioburden-Testmethoden sowie moderne mikrobiologische Schnellmethoden.
Auch die Frage, ob Bioburden-Proben eine begrenzte Haltbarkeit haben sollten, wird häufig thematisiert, ebenso wie der Umgang mit sogenannten „fehlenden Bioburden“-Ergebnissen. In Bezug auf Grenzwerte taucht auch unter Experten die Frage auf, ob es sinnvoll ist, vordefinierte Bioburden- und/oder Endotoxin-Grenzwerte für vorgelagerte oder nachgelagerte Prozesse – einschließlich Fermentation – sowie für den Gesamtprozess festzulegen.
Ein weiterer Aspekt beim Thema Bioburden ist, welches Kontrollsystem bevorzugt werden sollte: ein zweistufiges System mit Warn- und Alarmlimits oder ein dreistufiges System, das zusätzlich eine Rückweisungsgrenze umfasst. Dabei spielt auch die Methode zur Festlegung der Grenzwerte eine Rolle, bspw. wie viele Datenpunkte dafür erforderlich sind und welche Philosophie bei neuen Prozessen ohne Erfahrungswerte angewendet wird.
Und auch das Abweichungsmanagement bietet Raum für Diskussionen: Wird im Falle von Grenzwertüberschreitungen grundsätzlich eine Identifizierung der Keime vorgenommen? Falls ja, in welchen Fällen – bei jeder Kolonie oder nur bei Überschreitungen? Ebenso stellt sich dem Anwender die Frage nach bevorzugten Identifikationstechniken sowie geeignete Maßnahmen im Falle von Grenzwertüberschreitungen.
Reinigung und Desinfektion

Mit dem Ansatz, Reinigung und Desinfektion als zwei getrennte Schritte zu betrachten und sich mit möglichen Risiken von Rückständen zu befassen, hat der Annex 1 auch Folgediskussionen ausgelöst. Ist eine getrennte Reinigung nötig, wenn gar keine signifikanten Verschmutzungen vorliegen? Spielen Desinfektionsmittelrückstände auf produktfernen Oberflächen wie dem Fußboden wirklich eine Rolle?
Oder bedeuten die Hinweise auf die Anwendbarkeit einzelner Annex-1-Prinzipien in nicht-sterilen Bereichen, dass dort auch eine umfängliche Validierung der Desinfektionsmaßnahmen erfolgen muss?
Dazu kommt, dass jetzt auch die USP, wie oben erwähnt, ihr Kapitel <1072> zum Thema Desinfektion überarbeitet und den neuen Entwurf zur Konsultation bzw. Kommentierung veröffentlicht hat.
Für den Bereich der Auswahl und Validierung von Desinfektionsmitteln und zur Erstellung eines entsprechenden Konzeptes bietet das USP Kapitel <1072> einen nützlichen Leitfaden, besonders für Betriebe, die von internationalen Behörden wie der US-FDA inspiziert werden. Dieses Kapitel wurde nun an mehreren Stellen überarbeitet und um neue Abschnitte ergänzt.
Zielsetzung: Kontaminationen verhindern
Das Kapitel befasst sich damit, dass für Räumlichkeiten, die bei der Herstellung von pharmazeutischen Produkten dienen, ein geeignetes Reinigungs- und Desinfektionsprogramm erforderlich ist, um Kontaminationen, sowohl chemischer als auch mikrobiologischer Art, zu verhindern. Das gilt selbstverständlich für sterile wie für nicht-sterile Arzneimittel.
<1072> beschreibt die Bedeutung und Durchführung der Reinigung und Desinfektion in Reinräumen. Ziel ist es, Rückstände, Partikel und Mikroorganismen von Oberflächen zu entfernen, um eine effektive Desinfektion zu ermöglichen. Dazu werden Reinigungsmittel, Enzyme, Chemikalien und mechanische Maßnahmen eingesetzt. Ein geeignetes Reinigungsprogramm ist entscheidend, um die Wirkung von Desinfektionsmitteln nicht zu beeinträchtigen. Das Kapitel behandelt:
- Auswahl geeigneter chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika
- Nachweis der bakteriziden, fungiziden und sporiziden Wirksamkeit
- Anwendung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in pharmazeutischen GMP-Umgebungen
- Anwendung relevanter Vorschriften und Sicherheitsaspekte
Es befasst sich nicht mit der Bildung von Biofilmen und deren Zusammenhang mit Desinfektionsmitteln und viruziden Mitteln. Das Kapitel weist darauf hin, dass Standardwerke zu den Themen Desinfektionsmittel und Antiseptika zusätzliche Informationen liefern können.
Es wird betont, dass beim Einsatz von Desinfektionsmitteln darauf zu achten ist, dass das Arzneimittel nicht mit unerwünschten chemischen Inhaltsstoffen oder deren Rückständen kontaminiert wird. Demzufolge sollte ein Reinigungs- und Desinfektionsprozedere so konzipiert sein, dass es nicht nur die mikrobielle Kontamination verhindert, sondern auch sicherstellt, dass es nicht zu einer Kontamination von Oberflächen und/oder Arzneimitteln mit Chemikalien bzw. Rückständen kommen kann.
An dieser Stelle wird nochmals hervorgehoben, dass diese Grundsätze je nach den potenziellen Risiken auch für nicht-sterile Darreichungsformen gelten. Außerdem liefert neben dem vorliegenden Kapitel auch das Kapitel <1115> „Bioburden Control of Nonsterile Drug Substances and Products“ weitere Hinweise.
Aktuelle Änderungen im United States Pharmacopeia (USP)
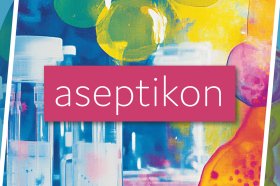
Der überarbeitete Entwurf von <1072> Desinfektionsmittel und Antiseptika basiert auf der vor 2013 offiziellen Fassung des Kapitels. Der vor mehr als zwei Jahren in PF 46(5) veröffentlichte Vorschlag wurde zurückgezogen und soll auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen überarbeitet werden. Nachfolgend eine kurze Übersicht über die vorgeschlagenen Änderungen, wie die USP sie auflistet. Sie lauten:
- Den Abschnitt „Definitionen“ zu entfernen, da Definitionen und Glossarbegriffe im Zusammenhang mit den Kapiteln zu Mikrobiologie in <1117.1> „Microbiological Chapters-Glossary“ zu finden sind.
- Ein Abschnitt mit detaillierten Methoden zur Dekontamination großer Räume, einschließlich Wasserstoffperoxid in der Gasphase und Chlordioxidgas, zu ergänzen.
- Entfernen der folgenden Abschnitte:
- Auswahl eines Antiseptikums für die Desinfektion der Hände und Operationsbereiche,
- Theoretische Erörterung der Desinfektionswirkung. - Erweiterung der Überlegungen zur Auswahl von Desinfektionsmitteln, einschließlich Bioburden, Wirkungsspektrum und Verträglichkeit mit Oberflächen.
- Erläuterungen zu Desinfektionsmittel-Challenge-Tests, einschließlich der empfohlenen Akzeptanzkriterien:
- Ein 2-log-Akzeptanzkriterium für Pilzsporen hinzufügen,
- Kleinere Coupongrößen (z. B. 1 oder 2 cm Durchmesser) für die Prüfung der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln hinzufügen, um Wirksamkeitsstudien zu vereinfachen. - Aktualisierung der Leitlinien für die Verwendung von Desinfektionsmitteln in einem Reinigungs- und Desinfektionsprogramm, einschließlich der In-situ-Qualifizierung der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln und der Personalsicherheit.
Damit sind nur einige Themen angeschnitten, die für die Qualität in der pharmazeutischen Herstellung von Interesse sind. Diese und viele weitere Themen werden im Rahmen der Aseptikon am 7. und 8. Oktober in Mannheim aufgegriffen, die erstmals in deutschsprachig das Thema Bioburden in einem zweitägigen Konferenzstrang aufgreift. Dort wird von Experten und Expertinnen aus der Industrie, aus Auftragslaboren und durch Mitglieder von Expertengruppen der Pharmakopöen das Thema ausführlich beleuchtet. In bis zu fünf Konferenzräumen werden die Themen Aseptische Herstellung, Mikrobiologie, Hygiene, Bioburden, Reinraum im laufenden Betrieb und virtuelles Training von Operatoren in über 50 Vorträgen thematisiert und diskutiert.

Axel H. Schroeder
Fachbereichsleiter, Concept Heidelberg
© Concept Heidelberg
Aseptikon 2025
Vom 7. bis 8.10.2025 findet in Mannheim der Kongress Aseptikon 2025 statt. In bis zu fünf Konferenzräumen und auf der Fachausstellung bieten über 50 Fachvorträge die Möglichkeit, sich mit den aktuellen wissenschaftlichen, technischen und regulatorischen Entwicklungen in den genannten Themen vertraut zu machen und mit Referentinnen/Referenten und Kolleginnen/Kollegen die Erfahrungen bei der Umsetzung zu diskutieren. Neu und erstmals in deutscher Sprache – eine zweitägige Vortragsreihe zum Thema Bioburden. Neben den klassischen Konferenzen zu Aseptik, Mikrobiologe und virtuellem Training wird, nach dem positiven Feedback des letzten Jahres, das Thema Reinraum im laufenden Betrieb weiter vertieft.
Weitere InformationenDieser Beitrag ist in CITplus 9/2025 erschienen
Lesen Sie mehr! Aktuelle Nachrichten, meinungsbildende Interviews, detaillierte Marktberichte und fundierte Fachartikel geben CITplus-Lesern den entscheidenden Informationsvorsprung!
Zur aktuellen Ausgabe









