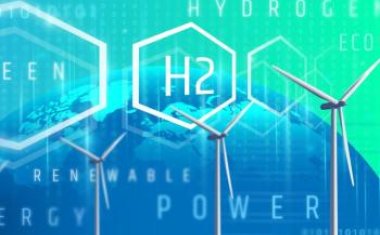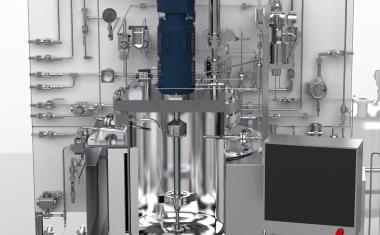Die mit dem Ventilator spricht– Betriebszuständen mit KI diagnostizieren
Ventilatoren erzeugen im Betrieb kontinuierlich Daten – Ziehl-Abegg nutzt diese Sprache mit Hilfe von KI zur präzisen Zustandsdiagnose. Eingebettete Sensorik und neuronale Netze ermöglichen eine Echtzeitanalyse direkt am Gerät. So wird Wartung planbar, Ausfälle vorhersehbar und die Lebensdauer von Komponenten optimal genutzt.
Autor: Moritz Schmitt Produktmanager Motoren und Elektronik ZIEHL-ABEGG
Datensprache und KI – Boten der Digitalisierung

Digitale Transformation heißt nicht erst seit ChatGPT auch Künstliche Intelligenz. Die ihr zugedachten Aufgaben umfassen sowohl repetitive als auch hochkomplexe Tätigkeiten. Generative KI kann aus menschlichen Eingaben Texte und Bilder kreieren, deskriptive KI komplexe Muster erkennen und Istzustände beschreiben. KI-Anwendungen sind bei Dienstleistungen ebenso zu finden wie in der Produktion.
Digitale Transformation heißt auch Kommunikation. Das Mittel hierzu besteht u.a. aus der Währung des digitalen Zeitalters, aus Daten, nicht nur aus solchen personenbezogener Art. Jede Maschine, im Falle der Lüftungstechnik jeder Ventilator, kommuniziert fortwährend durch im laufenden Betrieb erzeugte Daten. Sie richtig zu nutzen, heißt eine Art von Interaktion zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Spezies - Mensch und Maschine – und damit ein tiefgreifendes Verständnis zu ermöglichen. Denn mit allen Daten gibt die Maschine etwas über sich und ihren Zustand preis.
Die Herausforderung besteht darin, die Sprache des Ventilators zu hören und zu verstehen. Ziehl-Abegg setzt genau hier an, indem Künstliche Intelligenz zur Auswertung herangezogen und so zur Übersetzerin der auf Daten beruhenden Ventilatorrede wird.
Die traditionelle Wartung versus eingebettete Sensorik

Den Ventilator in Gänze zu verstehen, kann von besonderer Bedeutung werden, wenn es um potenzielle Ausfälle oder die Notwendigkeit von Wartungstätigkeiten geht. Der traditionelle Weg wartet so lange ab, bis Komponenten funktionsunfähig werden. Dies bedeutet meist ungeplante, teils zu besonders ungünstigen Zeitpunkten erfolgende Ausfallzeiten. Auch Folgeschäden an benachbarten Komponenten sind möglich. Hilfreich können nach festgelegten Intervallen vorgenommene Eingriffe sein, bei denen Stillstandszeiten geplant werden. Es kann dabei allerdings passieren, dass z.B. auch noch komplett intakte Teile ausgetauscht werden. Zudem schützen Erfahrungswerte oder Angaben zur Funktionsdauer nicht vor ungeplanten und „außer der Reihe“ ausfallenden Komponenten. Jedes Produkt ist anders, unterschiedliche Abläufe lassen keine hundertprozentige Aussage über den Zustand zu. D.h. auch, dass Ressourcen wie Ersatzteile jederzeit verfügbar und damit auf Lager gehalten werden, und dass Service-Mitarbeiter auch kurzfristig zur Verfügung stehen müssen.
Es ist also nahezu unmöglich, den in jeder Hinsicht geeigneten Zeitpunkt für das Eingreifen in den Betrieb zu Wartungszwecken zu finden. Dabei ist es selten der Fall, dass ein Schaden abrupt auftritt, vielmehr deutet er sich im Vorfeld oftmals an. Doch wenn man die stillen Ankündigungen nicht sehen kann und von außen nicht erkennt, dass eine Komponente nicht mehr optimal läuft, kann eben nur auf Vermutung hin gehandelt werden. Wenn der Ventilator aber über sich und seinen Betriebszustand jederzeit Auskunft geben könnte, wäre der Mensch stets informiert. Die datenbasierte Sprache des Ventilators zu verstehen, bedeutet also, genau zu wissen, wie es um ihn und seine Komponenten in jedem einzelnen Moment bestellt ist. Das Auftreten einer nahenden Störung könnte deutlich genauer prognostiziert werden.
Auf diesem Weg ist Ziehl-Abegg schon in der Vergangenheit mehrere wegweisende Schritte gegangen. Die Herausforderung ist zunächst einmal das Gewinnen der Daten. Die Ventilatoren wurden mittels perfekt auf die Anforderungen der Lüftungstechnik abgestimmter Sensorik zum Sprechen gebracht. Durch bereits im Ventilatormotor vorhandene Sensoren können direkt vor Ort Schwingungs- und Telemetriedaten gewonnen werden, relevante Parameter sind beispielsweise Schwingungen in den Achsen, Drehzahlen, Temperaturen und aufgenommener Strom.
Eingebettete KI - Das Verstehen der Daten in Echtzeit
Die gewonnen Daten konnten nun durch das Versenden an die Cloudlösung ZAbluegalaxy visualisiert werden. Die Sprache des Ventilators wurde also sichtbar. Somit konnten Messdaten überwacht, protokolliert sowie historisiert werden. Die hierdurch möglichen Analysen ließen bereits erste Rückschlüsse auf den Zustand des Ventilators zu, z.B. ließen sich auf dieser Basis Warnmeldungen ausgeben.
Der Herausforderung, die Sprache auch zu verstehen und dementsprechend handeln zu können, wurde also bereits begegnet. Doch mehrere Faktoren machen es menschlichen Fachkräften nahezu unmöglich, die Daten zeitnah zu lesen, auszuwerten und zu interpretieren. Dazu zählen insbesondere ihre reine Menge sowie die Tatsache, dass sich manche Betriebszustände nicht allein aus bestimmten einzelnen Daten ablesen lassen, sondern lediglich aus Kombinationen. Von menschlicher Seite ist eine fortwährende Überwachung der Daten inklusive ihrer Analyse nicht machbar. Und wäre auch nur ein kleiner Teil annähernd verarbeitet, wäre er schon nicht mehr aktuell. Echtzeitdaten können demnach nicht sinnvoll genutzt werden. Bei einem Störfall wäre der Zenit für rechtzeitiges Handeln evtl. überschritten.
Genau hier kommt Künstliche Intelligenz in Form eines Neuronalen Netzes ins Spiel. Neuronale Netze, bestehend aus miteinander verbundenen künstlichen Neuronen in mehreren Schichten, sind Meister im Empfangen und Analysieren von Daten. In der Eingangsebene kommen die Daten in Form eines Inputvektors an und laufen durch einen oder mehrere Hidden Layer zur Ausgangsschicht. Auf jeder Ebene findet eine Datenverarbeitung statt. In der Ausgangsebene werden die so berechneten Werte als Outputvektor in eine für den Menschen lesbare Form transformiert, ein Prozentwert gibt z.B. Auskunft über den Zustand einer Komponente. Ist eine bestimmte Schadenswahrscheinlichkeit gegeben, wird eine Warn- oder Fehlermeldung ausgegeben.
Auf Basis der Auswertungen ist die KI also in der Lage, bei Bedarf Handlungsempfehlungen zu geben. Das Neuronale Netz kann zudem bei der Diagnose von Problemen oder Ausfällen helfen, indem es anhand von Betriebsdaten mögliche Ursachen identifiziert. Die Künstliche Intelligenz übernimmt damit die Rolle eines Mitarbeiters, der fortwährend der Kommunikation des Ventilators zuhört, seine Worte versteht, interpretiert und Vorschläge zum Handeln unterbreitet. Daten, die bisher aufgenommen wurden, können jetzt sinnvoll verarbeitet werden.
Das Onboarding der KI – Die Aufbereitung der Daten
Doch wie jeder Mitarbeiter muss auch die KI eingearbeitet werden. Ziehl-Abegg hat sie in aufwendigen Vorarbeiten trainiert: Millionen Datenpunkte wurden gesammelt, aufgenommen und einzelnen Betriebszuständen zugeordnet. Dies machte Entscheidungen nötig, welche Datenpunkte und Merkmale für die Analyse bestimmter Zustände wichtig sind und dementsprechend stark gewichtet werden müssen. Störungen und Schäden wurden simuliert, so dass die KI das Normalverhalten des Ventilators kennt und wie ein Spürhund kleinste Abweichungen sofort registriert. Damit einhergehend wurden die riesigen Datenmengen mittels Feature Engineering vorbereitet, nämlich standardisiert und transformiert. Die Daten müssen immerhin nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch in einheitlicher Form vorhanden sein, damit Vergleiche zwischen ihnen möglich sind. Der KI wird also ein Leitfaden mitgegeben, an dem sie sich orientieren kann.
Insbesondere, um die Berechnungen auf der Komponente selbst durchführen zu können, ist es zudem nötig, die Daten herunterzubrechen, was den Spagat zwischen Vereinfachung und dennoch höchstmöglicher Genauigkeit erforderlich macht. Die gesamte Aggregation erhöht allerdings die Prägnanz - zu viele Daten und zu viele Merkmale würden eine präzise Analyse eher erschweren. Die trainierte KI kann nun noch auf Validierungsdaten getestet werden.
Perfektes Match - Expertenwissen und KI

Daten und KI müssen also erst auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Auch danach übernimmt die KI zwar eine wichtige Position, wird indes nicht zum Alleinentscheider. Sie übersetzt mittels grandioser Analysefähigkeiten die Sprache des Ventilators für die menschliche Fachkraft und gibt Empfehlungen. Die Entscheidung, wie mit einer Handlungsempfehlung umgegangen wird, muss jedoch nach einer Überprüfung, die eine Bewertung der Informationen und die Berücksichtigung möglicher weiterer Faktoren einschließt, von der menschlichen Expertise getroffen werden. Der Mensch muss demnach weiterhin über Fach- und Kontextwissen verfügen, die KI kann nicht von allein aktiv werden. Es ist möglich, den Ventilator so einzustellen, dass er im Falle einer Fehlermeldung sogleich abschaltet – doch dieses Feature muss aktiv angefragt werden und ist eben keine Standardeinrichtung.
Insgesamt arbeiten also künstliche und menschliche Intelligenz eng zusammen. Die Möglichkeit der Echtzeitüberwachung und die Analysefähigkeiten der räumlich direkt an der Komponente sitzenden KI ergeben ein perfektes Zusammenspiel mit dem über Fachwissen verfügenden und zur Entscheidung fähigen und berechtigten Menschen.
Die revolutionierte Wartung – Handlungsvollmacht durch KI
Es zeigt sich, dass der Mensch sogar über mehr Handlungsspielraum verfügt als zuvor. Denn aus seiner Zusammenarbeit mit der KI ergibt sich ein modernes Wartungssystem, das in mehrfacher Hinsicht punkten kann. Ob zeitlich vorhersehbar oder unerwartet auftretend, jede Schädigung und damit jeder potenzielle Ausfall wird nun angekündigt und lässt Zeit zur Reaktion. Damit verschiebt sich das menschliche Handeln mehr in Richtung eines Agierens als eines rein vorsorglichen oder notfallmäßigen Reagierens. Planbarkeit ist hier das Stichwort. Auch unvorhergesehene Ausfälle kündigen sich an und andererseits ist es nicht mehr nötig, intakte Teile, die vielleicht unvorhergesehen länger halten würden, auszutauschen. Die Lebenszeit eines Bauteils kann bis zum Maximum genutzt werden, der Rattenschwanz, den ein defektes Teil verursachen kann, wird abgemildert.
Die Ankündigung lässt in der Regel genug Raum, um einen günstigen Zeitpunkt für die Wartung festzusetzen. Laufende Prozesse werden hierbei optimiert, die Zuverlässigkeit des Ventilators erhöht sich. Stillstandzeiten bestehen nur noch aus der eigentlichen Wartungszeit. Mitarbeiter müssen nicht mehr auf Abruf bereitstehen und Ersatzteile nicht unbedingt auf Lager sein. Zeit und Kosten für die Instandhaltung werden auf das Minimum reduziert. Die Wartung wird nicht mehr zu einem lästigen überraschenden Übel, das den Betrieb unterbricht, sondern ist gewissermaßen in diesen eingebettet.
Neben den genannten Vorteilen durch die Wartungsoptimierung gibt es weitere. Mit der Zeit wird es möglich, bestimmte Problembereiche zu identifizieren, z.B. bei wiederkehrenden ähnlichen Fehlermeldungen, oder die Zeit bis zum Auftreten erster Fehler zu definieren, auch umgebungsabhängig. Betriebsparameter können bei Bedarf leichter angepasst werden. Wartungspläne werden nicht überflüssig, können aber optimiert werden. Generell ist es möglich, den Ventilator und seinen Betrieb auf einem neuen Level kennenzulernen, was ganz neue Wartungsstrategien ermöglicht.
Die Bedeutung von Zeit und Raum – Das eingebettete System
Neben dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz generell ist es besonders der Einsatz eines eingebetteten Systems, der hervorzuheben ist. Genauer gesagt liegt das „embedded system“ in doppeltem Sinne vor. Die Sensorik muss nicht extra beschafft werden, sondern befindet sich bereits im Motor selbst – abgestimmt auf die Erfordernisse des Ventilators, während externe Sensorik möglicherweise nicht alle relevanten Daten erfassen könnte.
Die KI muss nicht hinzugekauft werden, sondern ist ebenfalls schon im Zentrum des Geschehens ansässig. Zusätzliche externe Software oder sonstige Infrastruktur wie Datenanalyseplattformen sind nicht nötig.
Ein Verbinden des Ventilators mit einem Gateway und der Datenversand an die Cloud – wobei die Daten aktiv vom Nutzer angefordert werden müssen – ist möglich, für die Auswertung gerade im Falle eines einzigen Gerätes aber nicht entscheidend. Die Vorteile sprechen für sich. Es gibt nahezu keine Latenzzeiten, die Analyse wird wirklich zu einer Echtzeitlösung. Wird die Visualisierung oder Speicherung der Daten gewünscht oder sollen mehrere Geräte miteinander vernetzt werden, übernimmt die Cloud den hierfür entscheidenden Part. Die Menge der übertragenen Daten wird also reduziert, weniger Netzwerkbelastung ist die Folge. Dies bedeutet dann auch einen Vorteil für diejenigen Daten, die doch übertragen werden sollen. Die Cloud kann die Arbeit der KI nach außen sichtbar machen, während die KI ihrerseits dafür sorgt, dass lediglich bereits aufgearbeitete sowie verarbeitete und damit hochwertigere Daten verschickt werden.
Ziehl-Abegg geht seinen eingeschlagenen Weg, ohnehin vorhandene Daten, die den Zustand des Ventilators genau beschreiben, zu nutzen, konsequent weiter. Künstliche Intelligenz ist hier kein Nice to have, sondern ein elementarer Bestandteil des nächsten Schritts. Mit der KI-Lösung wurde ein Instrument geschaffen, dass auch in der Lüftungstechnik die Wartung revolutioniert. KI übersetzt die datenbasierte Sprache des Ventilators und wird zur „Kommunikationsintelligenz“. Mit ihrer Beschreibung von Betriebszuständen lassen sich Vorhersagen für mögliche Ausfälle treffen, die deskriptive KI wird zur prädiktiven.
Standardmäßig kann sie in Zukunft in jedem Ventilator verbaut sein und damit den Weg ebnen für ganz neue Arbeitsweisen. Mit ihr bekommt der Betreiber des Ventilators einen fortlaufend anwesenden Servicemitarbeiter an die Hand, der optimal aufbereitete Daten zu jeder Zeit analysiert und Schlüsse aus ihnen zieht. Paradoxerweise verhilft gerade dieser zusätzliche Schritt der Hilfestellung zu mehr Autonomie durch verbesserte Handlungsmöglichkeiten. An anderer Stelle fällt dafür ein Schritt weg: Durch die eingebettete Lösung ist die Datenübertragung nicht unbedingt nötig. Das aktuellste Mittel der Digitalisierung, die KI, macht also eine ständige Anbindung ans Netzwerk unnötig und optimiert gerade dadurch den Einsatz der Cloud. Somit steht die KI einerseits für sich, ergibt aber auch ein optimales Wechselspiel in einer Hybridlösung mit ZAbluegalaxy.