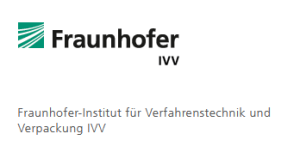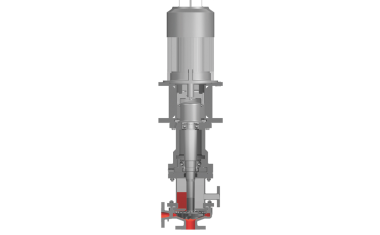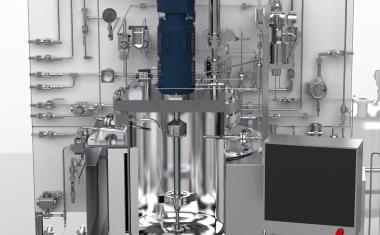Kartoffelprotein hat außerordentliche ernährungsphysiologische und funktionellen Eigenschaften und kann somit vielseitig in Lebensmitteln eingesetzt werden.
Anna Maria Tschigg, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fraunhofer IVV

Im Fraunhofer-Leitprojekt „FutureProteins“ werden geschlossene Agrarsysteme entwickelt, um alternative Proteine, u. a. aus Kartoffeln, ressourcenschonend zu erzeugen. Kartoffelprotein zeichnet sich durch seine außerordentlichen ernährungsphysiologischen und funktionellen Eigenschaften aus und kann somit vielseitig in Lebensmitteln eingesetzt werden. Die Gewinnung von funktionellem Kartoffelprotein oder der bisher nicht genutzten Proteine aus dem Fruchtwasser stellt eine Herausforderung dar, die jedoch mithilfe innovativer Verfahren gelingt.
Am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV wird die Filtration genutzt, um qualitativ hochwertige Proteine zu gewinnen. Dies ebnet den Weg, um einen wichtigen Beitrag zur Proteinversorgung zu leisten.
Resiliente Proteinproduktion
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln gewinnen nachhaltige Proteinquellen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Im Fraunhofer-Leitprojekt „FutureProteins“ werden geschlossene Agrarsysteme für die Kultivierung und Herstellung alternativer Proteine unter weitgehender Nutzung von Nebenströmen sowie Kopplung von Stoff- und Energiekreisläufen entwickelt. Zur Kultivierung pflanzlicher Proteinquellen wird in „FutureProteins“ ein verbessertes Vertical Farming System entwickelt. Hierdurch kann der Wasserverbrauch um bis zu 95 % und der Düngerbedarf um 50 % gesenkt werden, während Pestizide vollständig vermieden werden.
Chancen und Herausforderungen
In „FutureProteins“ wurden dabei Kartoffeln als eine mögliche Zielpflanze ausgewählt und in geschlossenen Agrarsystemen kultiviert. Kartoffelprotein sticht aufgrund seiner vielversprechenden ernährungsphysiologischen und exzellenten funktionellen Eigenschaften am Markt der pflanzlichen Proteine deutlich hervor[1]. Diese vielseitigen Eigenschaften führen dazu, dass Kartoffelprotein in unterschiedlichsten Produkten eingesetzt werden. So findet man es bereits in unterschiedlichen Produkten im Supermarkt einschließlich Saucen, Wurstersatzprodukten und Süßwaren.
Die Gewinnung von Kartoffelproteinen aus dem Fruchtwasser der Stärkeverarbeitung ist jedoch herausfordernd. So ist es nötig, Bräunungsreaktionen zu vermindern, toxische Substanzen (Glykoalkaloide) im Prozess abzureichern, die funktionellen Eigenschaften zu erhalten und gleichzeitig die sensorischen Eigenschaften von Kartoffelproteinen zu verbessern[2].
Kartoffelprotein als Lebensmittelzutat nutzen
Die Kartoffel ist als weltweit drittwichtigste Kulturpflanze nicht nur ein bedeutendes Nahrungsmittel, sondern auch eine vielversprechende Proteinquelle. Obwohl die Knollen nur etwa 2 % Protein enthalten, ist dieses aufgrund seiner Aminosäurezusammensetzung und seinen funktionellen Eigenschaften eine attraktive Wahl für die Lebensmittelindustrie. Kartoffelprotein zeichnet sich im Vergleich zu anderen pflanzlichen Proteinen durch einen hohen Gehalt an unentbehrlichen Aminosäuren aus. Zudem ist es leicht verdaulich und muss nicht als Allergen gekennzeichnet werden[3]. In der Europäischen Union werden jährlich 7,5 Mio. t Kartoffeln für die Stärkeproduktion verwendet, wobei proteinreiches Kartoffelfruchtwasser als Nebenprodukt anfällt[4].
Die Gewinnung von funktionellen Kartoffelproteinen ist jedoch herausfordernd, da dieses im Gegensatz zu anderen pflanzlichen Proteinen besonders empfindlich auf äußere Einflüsse wie Hitze, pH-Wert oder auch mechanische Einwirkung reagiert. Während traditionelle Methoden wie Säure- und Hitzefällung Kartoffelproteine liefern, die für den Einsatz in Lebensmitteln ungeeignet sind und somit vorrangig als Futtermittel verwendet werden, liefern neuere Techniken unter Zuhilfenahme von Filtration und/oder chromatographischen Aufreinigungsverfahren, wie bereits am Markt verfügbar, verbesserte Kartoffelproteinisolate mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften[2]. Höhere Kosten und technische Herausforderungen beeinträchtigen hier jedoch die wirtschaftliche Rentabilität.
Neben dem Anbau in geschlossenen Systemen wird im Rahmen von „FutureProteins“ an der Gewinnung von Kartoffelprotein durch Filtration sowie dem Einsatz des Rohstoffs in Lebensmitteln geforscht. Membranfiltration wie Ultra- und Diafiltration ist eine weit verbreitete Technik in der industriellen Proteinproduktion und wird für die Aufkonzentrierung und Aufreinigung von Proteinen eingesetzt. Am Fraunhofer IVV in Freising wurde der Einfluss verschiedener Faktoren wie Einsatz verschiedener Additive zur Reduktion von Bräunungsreaktionen, sowie pH und Temperatur während Proteinisolierung auf die sensorischen und funktionellen Eigenschaften der Kartoffelproteine untersucht.
Hierbei wurde nicht nur die Filtrationsleistung und die Wirtschaftlichkeit des Prozesses, sondern auch die Qualität der Kartoffelproteine inklusive funktioneller und sensorischer Eigenschaften untersucht und durch geeignete Auswahl an Prozessbedingungen verbessert. Die so hergestellten Kartoffelproteine wurden und werden aktuell in verschiedenen Modellrezepturen appliziert, um ihr Anwendungspotenzial in der Lebensmittelindustrie zu demonstrieren.
Zu den klassischen Funktionen von Proteinen in Lebensmitteln zählen die Stabilisierung von Emulsionen, Schäumen und Gelen. Kartoffelprotein bietet hier, wie bereits erwähnt, bemerkenswerte funktionelle Eigenschaften. Dies ist besonders in Anbetracht von derzeitigen Trends wie pflanzenbasierte Ernährung und Clean Label von großem Interesse für die Lebensmittelindustrie, da die Formulierung von Produkten unter Berücksichtigung dieser Verbraucherpräferenzen oft Schwierigkeiten birgt. Kartoffelprotein erweist sich hier als regelrechter Allrounder; neben seiner sehr hohen Löslichkeit und herausragenden emulgierenden Eigenschaften weist der Rohstoff auch sehr gute schaumbildende und gelierende Eigenschaften auf.
In emulsionshaltigen Systemen, wie etwa Dressings, ermöglicht der Einsatz von Kartoffelprotein auch in Kombination mit weiteren pflanzlichen Proteinen die Bildung besonders feiner Öltröpfchen. Dies verhindert Phasentrennung und ist entscheidend für eine hohe Lagerstabilität. Kartoffelprotein eignet sich zudem hervorragend als Ersatz für Hühnereiweiß in aufgeschäumten Systemen wie Meringue. Auch besitzt es bekanntermaßen sehr gute Geliereigenschaften. Durch Anpassung von Herstellprozessen und Optimierung von Rezepturen können auf Basis von Kartoffelprotein feste und klare Gelsysteme entwickelt werden.
Fazit
Kartoffelprotein stellt eine nachhaltige, funktionelle und ernährungsphysiologisch wertvolle Zutat für die Lebensmittelindustrie dar. Durch die Optimierung verschiedener Schritte des Herstellverfahrens ist es gelungen, ressourcenschonend sensorisch verbesserte und funktionelle Kartoffelproteine herzustellen und diese in verschiedenen Lebensmitteln einzusetzen.
Die Erkenntnisse aus dem Projekt „Future Proteins“ tragen zu einer resilienten Proteinversorgung der Zukunft bei und leisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Für weitere Informationen über die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie den Einsatz von Kartoffelprotein steht das Fraunhofer IVV gerne zur Verfügung.
Quellen
[1] Hussain, M., et al., Food Research International 148, 1-11 (2021)
[2] Løkra, S., et al. Food 3, 88-95 (2008)
[3] Hu, C., et al., Innovative Food Science & Emerging Technologies 91, 1-12 (2024)
[4] Starch Europe, The EU Potato Starch Value Chain, Sustainability and the EU Green Deal (2021)

Autorin
Anna Maria Tschigg,
wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Fraunhofer IVV
Anbieter